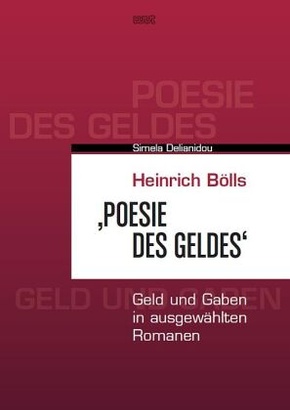Heinrich Bölls 'Poesie des Geldes' - Geld und Gaben in ausgewählten Romanen
| Verlag | WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier |
| Auflage | 2025 |
| Seiten | 234 |
| Format | 15,0 x 0,8 x 21,0 cm |
| Gewicht | 380 g |
| ISBN-10 | 3989400630 |
| ISBN-13 | 9783989400634 |
| Bestell-Nr | 98940063A |
Heinrich Böll hinterlässt - wie diese kulturkritische, ökonomisch reflektierte Studie demonstriert - mit seinen frühen Romanen Der Engel schwieg (1949-1951/1992), Billard um halb zehn (1959) und Ansichten eines Clowns (1963) eine 'Poesie des Geldes', die an eine religiöse, mithin urchristliche 'Ästhetik des Humanen' anknüpft. Er stellt in diesen Texten eine diachrone Betrachtung des Geldes und der Gabenpraxis an, geht kritisch mit verschiedenen Geldtheorien und Werteordnungen um und legt Mythenbildungen offen. Dabei wirft er einen kritischen Blick auf verschiedene Phasen der deutschen Wirtschaftsgeschichte: von der ersten Gründerzeit im Kaiserreich, dem Wirtschaftsaufschwung im Nationalsozialismus, der vermeintlichen "Stunde Null" nach 1945 bis hin zum "Wirtschaftswunder" in der jungen BRD. Böll bedient sich einer spezifischen literarischen Fortschreibung, der Verbindung von littérature engagée und l'ar¬gent engagée, und entwirft bereits zu diesem frühen Zeitpunkt sein Gegen¬model l, das das Thema Ökonomie wieder an die Wirtschaftsethik anzubinden sucht und explizit die Frage nach der Aufgabe der Kunst als einer "Poesie der Einmischung" stellt.
Simela Delianidou studierte Germanistik und Politikwissenschaften an der Universität Trier und promovierte dort 2001 mit einer Arbeit über "Frauen, Bilder und Projektionen von Weiblichkeit und das männliche Ich des Protagonisten in Franz Kafkas Romanfragmenten unter besonderer Berücksichtigung der Schuldfrage im Proceß". 2003-2005 war sie als Lektorin im Fach Deutsch als Fremdsprache an der Universität Thessaliens in Volos (Griechenland) tätig. Von 2005 bis 2012 war sie Lecturer, seit 2012 ist sie Assistant Professorin für deutsch¬sprachige Literatur- und Kulturwissenschaften an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki (Griechenland) mit Arbeits¬schwer¬punkten rund um die deutschsprachige Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts.
INHALT
I. MYTHEN DES GELDES1
1. Einleitung: "l'argent pure - l'argent engagée"1
2. Mythen des Geldes10
2.1 Was ist Geld? Annäherung Nr. 1: Instrumentale (neo)klassische Geldtheorie und ihre Grenzen10
2.2 Was ist Geld? Annäherung Nr. 2: Desideratum kulturtheoretischer, kulturanth-ropologischer Geldtheorien18
2.2.1 Karl Polanyi und Marcel Mauss: Gesellschaftsbildende Funktion der Ga-ben und des Geldes21
2.2.2 Geldtheorien und Ethik26
2.2.3 David Graeber: Geldtheorien und Schulden28
2.2.4 Michel Foucault und Jean Baudrillard: Referenzwandel und Referenzlo-sigkeit des Geldes33
II. ÖKONOMIE UND ÖKONOMIK ALS NARRATION: "STUNDE NULL" DER WERTEORD-NUNGEN IN DER ENGEL SCHWIEG (1949-1951/1992)?40
1. Verzögerte Publikationsgeschichte40
2. Geld und andere Wertmaßstäbe: Differente Maßeinheiten und Werteordnungen als Medien von Kritik in der Trümmerliteratur nach 194545
2.1 Trümmerrealität 1945 in Zahlen45
2.2 Tauschwert des Geldes und anderer Wertmaßstäbe: Der Schwarzhandel als Brennglas48
2.3 Ökonomie und Literatur - Fiktionalität als Verbindung53
2.4 Konfrontation differenter Werteordnungen - von Postkarten, Madonnen und Dreck/Schmutz55
3. Geld versus Gabe: Außergewöhnliche Gabenpraktiken63
3.1 Gabenpraktiken: ethisch-religiöse Werteordnung nicht nur der Vertreter_innen der "lebendigen Kirche" als regressive Utopie70
3.2 Gabe der Liebe: Lebensmut statt Todessehnsucht in der "Stunde Null"87
3.3 Außergewöhnliche Gabenpraktiken und Schulden: Das Opfer des Heldentodes92
3.4 Geruch des Geldes: Blutspende, Geld und Blutgeld95
3.5 Geruch der Armut und kritische Bewertung der Masse101
4. "Wo Schweigen war, soll Literatur werden": Blutspeiende Ster